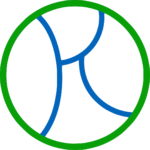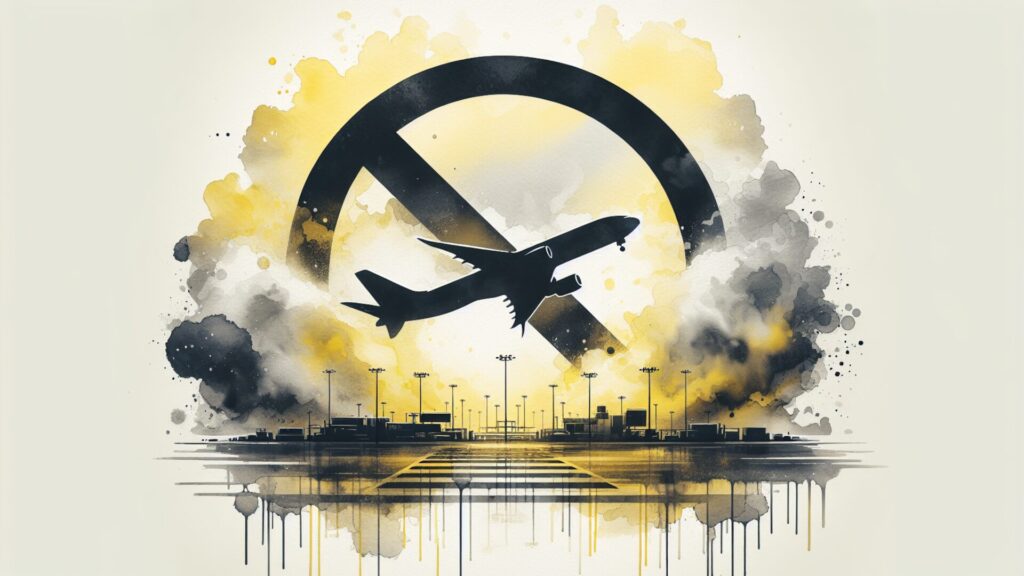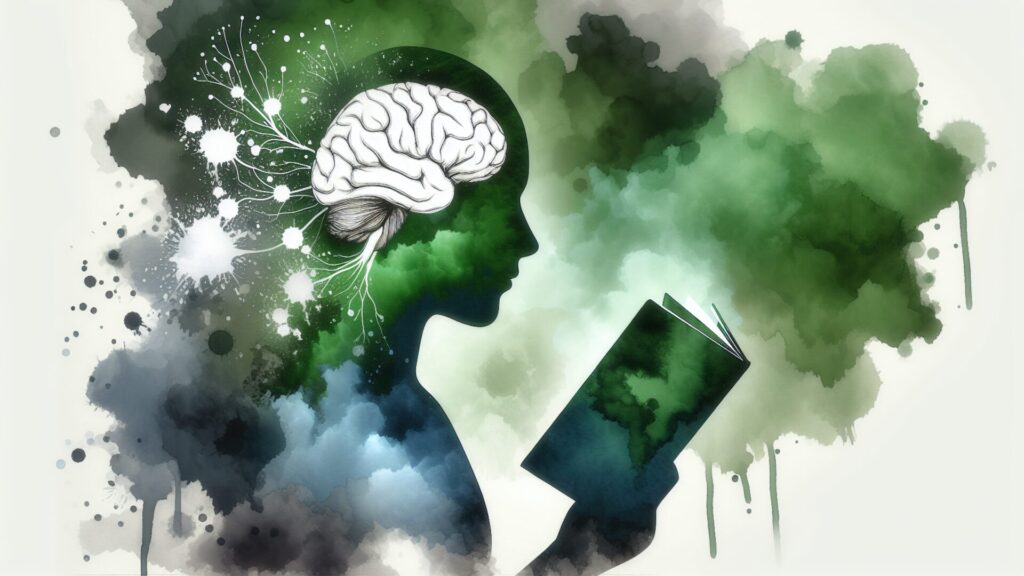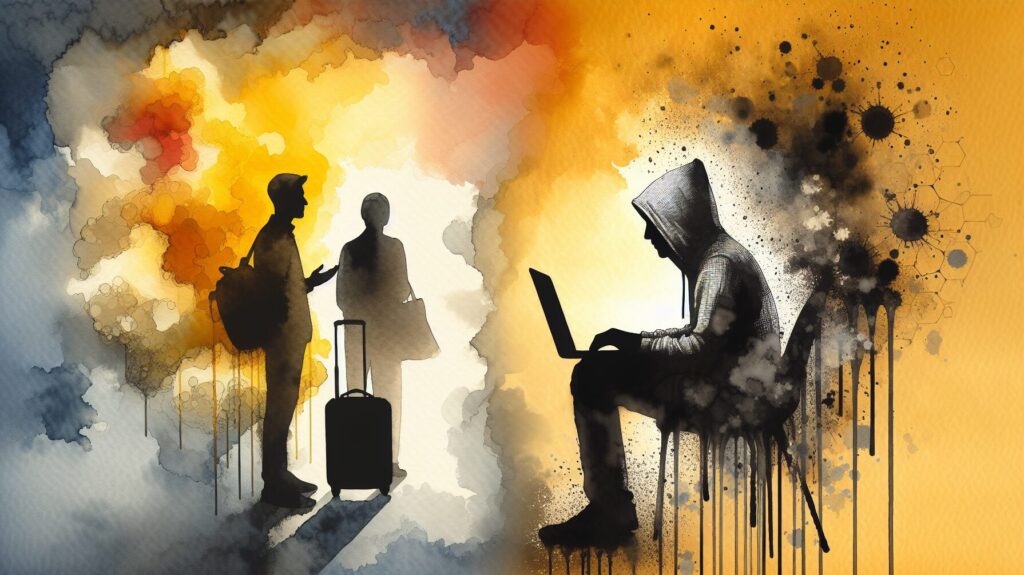Flugverspätung? Deine Rechte und wie du dich entschädigen lässt! [Sponsored]
Flugverspätungen können frustrierend sein und deinen Reiseplan erheblich durcheinanderbringen. Glücklicherweise schützt eine EU-Verordnung deine Rechte als Fluggast bei Verspätungen, Annullierungen und Überbuchungen.
Ich war selbst bereits betroffen und kenne den Stress! Doch dank meiner unglücklichen Erfahrung kann ich dir Schritt für Schritt erklären, welche Rechte du hast und wie du eine Entschädigung erhalten kannst!